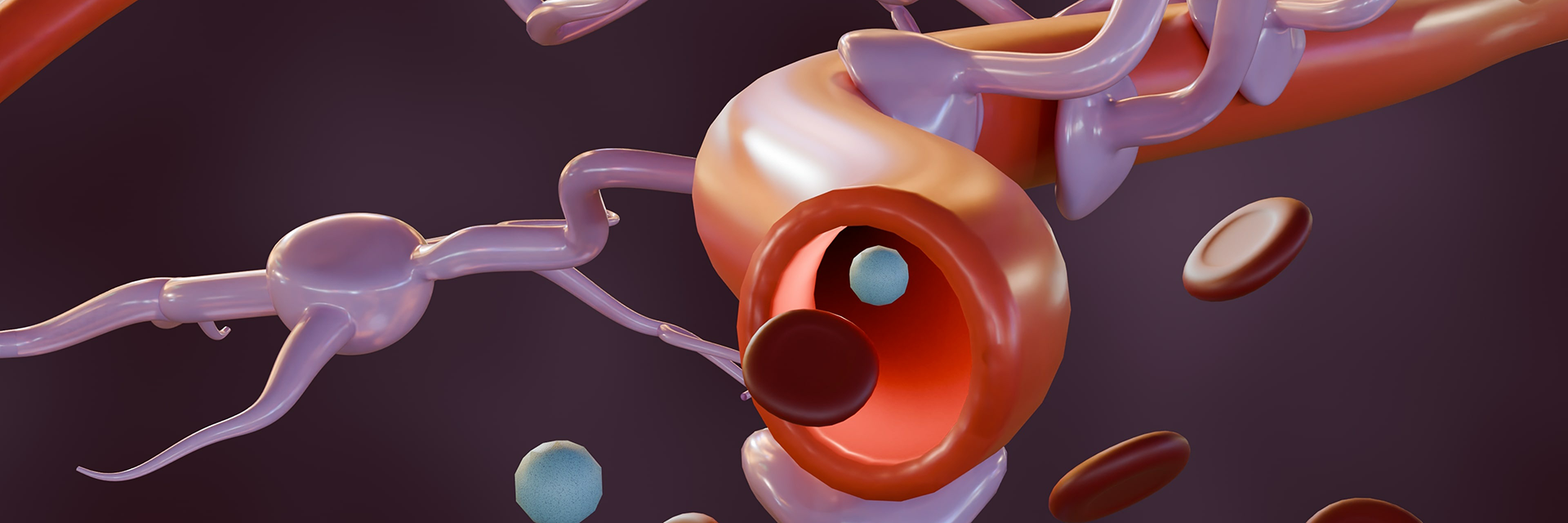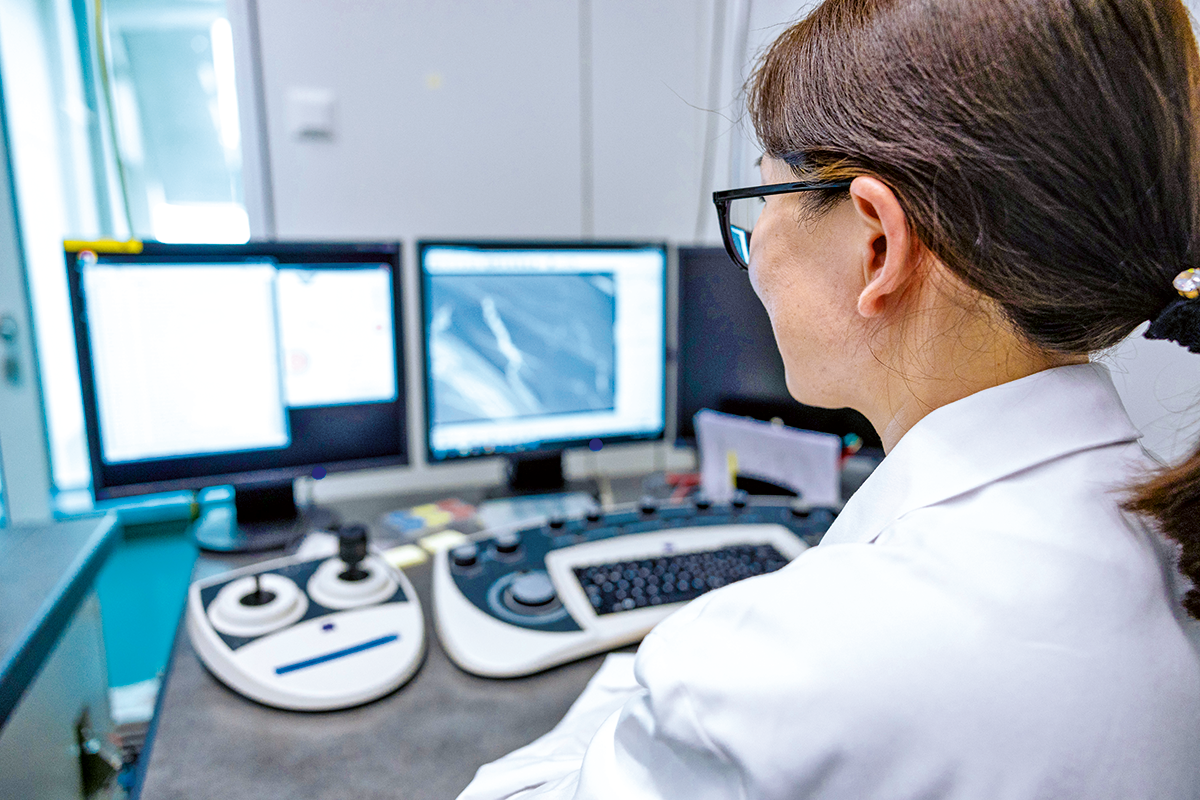Große Hoffnungen auf Nanomoleküle
Ein nanotechnologischer Schutzschild für die Enzymersatztherapie könnte helfen, dass diese ihre Zielstruktur im Gehirn erreicht
Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen in Zellen beschleunigen. Sie sind für den Abbau von Nahrung und Giftstoffen im Verdauungssystem und in der Leber zuständig und unterstützen beispielsweise die Entfaltung der DNA bei der Zellteilung und -replikation. Neben ihrer Rolle in unserem Körper sind sie aufgrund ihrer Eigenschaften als Katalysatoren auch als umweltfreundlichere Alternative zu chemischen Katalysatoren für chemische Reaktionen interessant.
Im Jahr 2016 entwickelten Wissenschaftler des Instituts für Chemie und Bioanalytik eine innovative Methode, um Enzyme in Nanopartikeln einzubauen und sie für Anwendungen in der Biokatalyse widerstandsfähiger zu machen. Sie gründeten das Unternehmen Inofea, das Lösungen für stabile, aktive und reine Enzyme für chemische Reaktionen und Produktionsprozesse anbietet.
Enzyme können auch als Therapeutika eingesetzt werden, wenn der Körper nicht genug davon selbst produziert. Aufbauend auf ihrer Enzym-Engineering-Technologie entwickelten Prof. Dr. Patrick Shahgaldian und sein Team Nanoarchitekturen, um empfindliche Enzymtherapeutika vor dem Abbau im Körper (z. B. im Darm) zu schützen. Das Team entwarf ein organisch-anorganisches Hybrid, das es den Enzymen ermöglicht, am Leben zu bleiben und ihre Ziele im Darm zu erreichen. Dadurch kann die Tablettenbelastung für Patientinnen und Patienten deutlich gesenkt werden.
Für die therapeutische Anwendung der Schutzschildtechnologie hat Shahgaldian im Jahr 2019 Perseo Pharma gegründet. Das Unternehmen führt derzeit präklinische Tests von vier Verdauungsenzymtherapien durch. Gleichzeitig wird untersucht, ob mit einem ähnlichen Ansatz ein Enzymcocktail verabreicht werden kann, der die Stoffwechselaktivität in Krebszellen unterbindet.
Die nächste Herausforderung für Shahgaldian und sein Team ist eine weitere schwierige Umgebung für Medikamente: das Gehirn. Diesmal arbeiten sie an Lösungen für lysosomale Speicherkrankheiten (LSDs), eine grosse Gruppe von Stoffwechselerkrankungen, die durch einen Enzymmangel im Lysosom verursacht werden. Bei etwa 50–70 Prozent der LSDs ist das zentrale Nervensystem betroffen. Enzymersatztherapien können bei einigen dieser Erkrankungen hilfreich sein, aber leider überwinden sie nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Shahgaldians Team versucht, dieses Problem zu überwinden, indem es ein äusseres Enzymschild entwirft, das die Enzyme nicht nur schützt, sondern - was noch wichtiger ist - an Rezeptoren an der Blut-Hirn-Schranke bindet, um den Transport über die Schranke zu ermöglichen.
"Durch die Dekoration der Enzyme mit Strukturen, die von den Endothelzellen des Gehirns erkannt werden und an die sie sich binden, könnte es möglich sein, die Enzyme ins Gehirn zu bringen. Wir hoffen, dass unser Ansatz zu neuen Behandlungsmöglichkeiten für lysosomale Speicherkrankheiten beitragen wird, die das zentrale Nervensystem betreffen", sagt Shahgaldian.
Eine weitere Strategie, die das Team in Zukunft erforschen könnte, ist die Entwicklung von Nanopartikeln für die intra-nasale Verabreichung. Die Verabreichung über die Nase ins Gehirn ist ein vielversprechender Weg, der einige mit der Blut-Hirn-Schranke verbundene Probleme vermeidet und für den sich Nanomoleküle besonders eignen.
Eckdaten | |
|---|---|
Partner: | Perseo Pharma |
Finanzierung: | Swiss Nanoscience Institute |